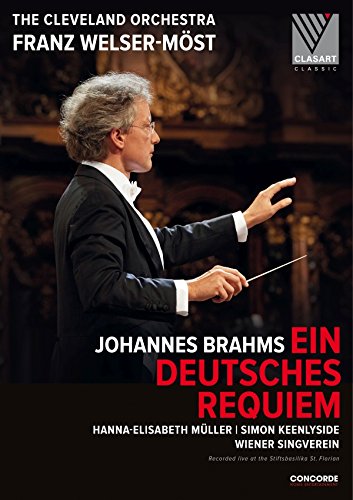Es hätte schlimmer kommen können. Der Seufzer der Erleichterung ist für Wiener Verhältnisse heutzutage schon ein ziemliches Lob für eine Neuinszenierung im Haus am Ring. Wobei der mit „Fidelio“ bestens vertraute Dirigent Franz Welser-Möst – von 2010 bis 2014 Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper– schon bei seinem Erscheinen euphorisch gefeiert wurde. Wenn sich jemand, so wie er, gegen gesundheitliche Gefährdungen stemmt, dann können sie in Wien auch fair sein und sogar herzlich ermutigen. Daneben hielt er, was man von ihm und dem Staatsopernorchester erwarten durfte: Einen durchdachten und leidenschaftlichen, aber auch sensiblen und pathetisch auftrumpfenden Beethoven.
Dass Welser-Möst auch am Ende noch vor allen anderen gefeiert wurde, lag wohl auch an der Verve, mit der er die 3. Leonoren-Ouvertüre bei geschlossenem Zwischenvorhang dirigierte. In Wien wird das traditionsgemäß seit Gustav Mahler vor der Schlussszene so gehalten. Im Programmheft verriet der Dirigent, dass er bei seinen vielen „Fidelio“-Dirigaten nur ein einziges Mal darauf verzichtet und dabei erkannt habe, „dass das Finale diesen letzten Kick benötigt, um wirklich abzuheben.“ Und er liefert den Kick und sorgt für das Abheben des Finales. Musikalisch jedenfalls.

Sanftes Infragestellen der Vorlage
Szenisch wird das Finale zur puren Deklaration. Da hört man mehr und Belangvolleres, als man zu sehen bekommt. Die bis dahin die Bühne beherrschende, geradezu an die Bastille erinnernde wuchtige Gefängnismauer von Julius Theodor Semmelmann hat sich wie ein Tor zur Freiheit geöffnet. Die Gefangenen müssen nicht mehr knien, der Minister (mit ausgestellter Würde: Simonas Strazdas) lässt unter dem Blitzlichtgewitter einer wohl von ihm bestellten Reportermeute die Fesseln lösen, und alle feiern die Gattenliebe. Mit jenem „Wer ein holdes Weib errungen, stimm‘ in unsern Jubel ein!“, das man besser nicht allzu intensiv hinterfragt. Im Hintergrund ragt da eine kitschige Leonoren-Statue in die Höhe, die sich schon durch ihre pure Größe und die heroische Haltung selbst in Frage stellt. Könnte es sein, dass da ein Mythos vor sich selbst erschrocken ist und den ihm dargebrachten, sich immer mehr steigernden Jubel abzuwehren versucht?
Ab und an blitzt die Skepsis gegenüber der Librettovorlage auch in der moderaten Bearbeitung von Paulus Hochgatterer auf. Joquino (abgebrüht und souverän: Daniel Jenz) darf etwa mit Blick ins Publikum anmerken, dass Rocco sonst „Tochtermann“ sage, wo es jetzt „Schwiegersohn“ heißt. Oder er darf den Wunsch, den Gefangenen ein wenig Sonnenlicht zu gönnen, den „Gutmenschen“ in seiner Umgebung zuschreiben. Dezenter Wortwitz, von dem man durchaus mehr vertragen hätte. Ansonsten verzichtet die Inszenierung ganz bewusst auf eine konkrete historisch politische Verortung und bleibt so allgemein wie irgend möglich.

Gold, überall Gold
In der Eingangsszene, für die die Gefängnismauer einen Einblick ins Innere erlaubt, findet sich Marzelline (bewusst treuherzig: Kathrin Zukowski) zwar nicht beim Bügeln wieder, sondern ist damit beschäftigt, die Zivilkleidung der gerade nach und nach eingelieferten Gefangenen in Kisten zu entsorgen wie bei der Sicherheitskontrolle auf dem Flughafen. Hier wird die Singspielsituation zwar andeutungsweise politisch und mit unsympathisch aggressiven Übergriffen Jaquinos auf seine Braut aufgeladen. Aber das war’s dann auch schon. Roccos (eloquent und ohne altväterliche Attitüde: Tareq Nazmi) Lob auf das Gold, das man zum Leben braucht, ist eine Szene im ziemlich spießigen Wohnzimmer des Gefängniswärters, in dem überall das Gold versteckt ist, das er den Gefangenen abgenommen hat. Das ist ein an sich starker Texteingriff, der aber bei den Taschenspielertricks, mit denen Rocco den kassierten Goldschmuck aus allen möglichen und unmöglichen Verstecken zaubert, irgendwie verpufft.

Verschiedene Facetten einer Figur statt Realismus
Wenn der als Puppenspieler bekannt gewordene Nikolaus Habjan Oper inszeniert, sind zwar keine harmlosen Puppenstuben-Spiele zu erwarten, aber mit diversen Verdopplungen der Sängerdarsteller durch Puppen-Alter-Egos darf (oder muss) gerechnet werden. Dass man bei dem neuen Staatsopern-„Fidelio“, der immerhin die sage und schreibe 55 Jahre im Spielplan stehende Otto-Schenk-Inszenierung ablöst, mit zwei verdoppelten Figuren davonkommt, geht beim eher konservativen Teil des Wiener Publikums wohl schon auf die Habenseite dieser Neuproduktion. Dass es die Titelfigur treffen würde, liegt sozusagen in der Natur dieser Partie. Die Frau, die sich als Mann verkleidet, in dem Gefängnis einen Hilfsposten erschleicht, in dem ihr Ehemann als politischer Gefangene eingesperrt ist, ist schon in der Vorlage ein Spiel in einer Maskierung, so dass der Schritt zur Verdopplung der Sängerin quasi auf der Hand liegt. Die Fidelio-Klappmaul-Puppe, die Bruno Belil gebaut hat und die von zwei Puppenspielern meist in der Nähe der singenden Malin Byström geführt wird, ähnelt allerdings auffallend der Sängerin – aber hier geht es ja eh nicht um Realismus, sondern um verschiedene Aspekte einer Person.

Nachfolger mit deutlich kürzerer Halbwertszeit
Das funktioniert, wenn die den Mann vorgebende Puppe sozusagen die von innen Singende als Frau betrachtet. Aber wenn die Puppe so tut, als käme der Gesang aus ihrem aufgerissenen Klappmaul, wird es albern. Dass sich der mit schlankem und betörend aufstrahlendem Tenor aufwartende David Butt Philip als Florestan die Aufmerksamkeit mit einer verzottelten Puppe teilen muss, obwohl er ja einfach nur er selbst ist, mag dann dem Bestreben, Parität zu wahren, geschuldet sein – so von selbst wie bei Leonore versteht sich das nicht. Immerhin gibt es auch hier die Möglichkeit, dass das sozusagen unversehrte Innere wortwörtlich auf das verunstaltete Äußere blicken kann. Bei dem vokal fulminanten Don Pizarro von Christopher Maltman ist der moralisch flexible Opportunismus von Rocco und Jaquino auf die Spitze getrieben. Der stellt sich tatsächlich in eine Reihe mit dem Minister, als der die große Wende verkündet. Dass er ernsthaft glaubt, damit durchzukommen, wirft ein eigenes Licht auf diese Gesellschaft, in der zumindest die eine Ungerechtigkeit korrigiert wurde.
Es war verblüffend, wie gelassen das Premierenpublikum darauf reagiert hat, dass man ihm ein liebgewonnenenes Otto-Schenk-Opernmöbelstück weggenommen und durch etwas ersetzt hat, das garantiert keine fünfzig Jahre hält. Aber wie gesagt, es hätte schlimmer kommen können.
Wiener Staatsoper
Beethoven: Fidelio
Franz Welser-Möst (Leitung), Nikolaus Habjan (Regie), Julius Theodor Semmelmann (Bühne), Denise Heschl-Sprung (Kostüme), Franz Tscheck (Licht), Simonas Strazdas (Don Fernando), Christopher Maltman (Don Pizarro), David Butt Philip (Florestan), Malin Byström (Leonore), Tareq Nazmi (Rocco), Kathrin Zukowski (Marzelline), Daniel Jenz (Jaquino), Chor und Orchester der Wiener Staatsoper