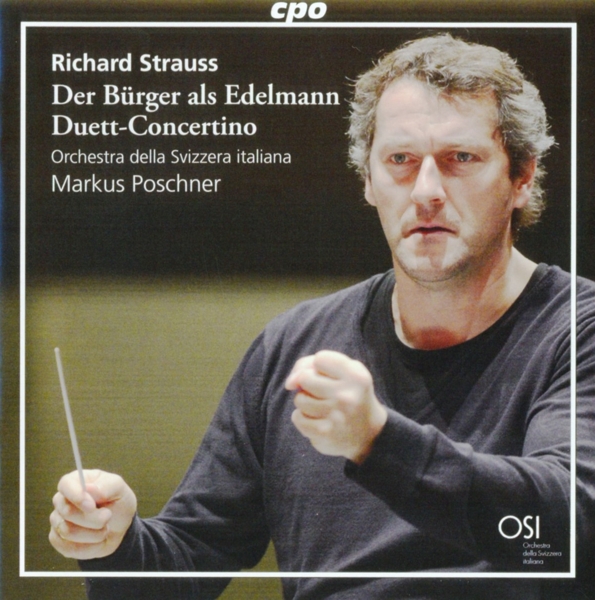Zu Beginn der Spielzeit 2025/26 hat Markus Poschner die künstlerische Leitung des Sinfonieorchesters Basel übernommen. Für den gebürtigen Münchner und Wahl-Wiener ist es nach zehn Jahren beim Orchestra della Svizzera italiana die nächste Chefposition in der Schweiz.
Wie haben Sie die ersten Wochen als neuer Chefdirigent in Basel erlebt?
Markus Poschner: Wenn nach jahrelanger Vorbereitung der Moment gekommen ist, an dem man mit seinem neuen Orchester vors Publikum tritt, ist das sehr erhebend und inspirierend. Ich spüre ob der langen Geschichte dieses Klangkörpers natürlich auch eine große Verantwortung. Das Spannende ist, die eigenen Ohren zu öffnen, sich von den Gegebenheiten vor Ort inspirieren zu lassen und in einen kreativen Dialog zu treten. Als Chefdirigent geht es mir darum, eine gemeinsame Vision zu entwickeln.
Was zeichnet den Klang dieses Orchesters aus?
Poschner: Der Klang spiegelt auf wundersame Weise die geografische Verortung der Stadt im Dreiländereck zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz wider. Es gibt hier diesen luziden, transparenten, luftigen und schwebenden Klang, der sicherlich von der französischen Seite herrührt. Dann treffe ich hier auf ein höchst präzises, motiviertes und stets hervorragend vorbereitetes Orchester. Wenn wir Mahler spielen, spüre ich diese gewisse Wärme im Klang, die man auch so aus Wien kennt. Und dann komme ich als Süddeutscher. Es ist herrlich, all diese Ingredienzen und Farben miteinander zu mischen und damit umgehen zu dürfen.
Wieso haben Sie sich zum Antritt für Mahlers zweite Sinfonie entschieden?
Poschner: Mahler hat sie selbst in Basel 1903 dirigiert und war sehr begeistert vom Orchester. Es gibt noch die Partitur von damals mit etlichen Eintragungen und Retuschen, die sicherlich mit der Akustik des Saals zu tun hatten, bis hin zu einigen neuen Mittelstimmen, die sonst nirgends zu finden sind. Zugleich gibt es eine große Mahler-Tradition in Basel, angefangen mit Felix Weingartner und später mit Moshe Atzmon, der in den 1970er-Jahren den ersten kompletten Mahler-Zyklus dirigiert hat. Es war naheliegend, sich mit diesem großen Schatz aus der Vergangenheit neu auseinanderzusetzen. Die Auferstehungssinfonie habe ich so oft dirigiert, dass ich schwören könnte, ich kenne jeden Winkel und jedes noch so versteckte Hinterzimmer der Partitur – und dann ist es doch jedes Mal wieder ganz anders mit einem neuen Ensemble. Das Ergebnis hier war eine Sternstunde für mich.
In den kommenden Jahren wollen Sie sämtliche Mahler-Sinfonien in Basel aufführen.
Poschner: Seine Musik ist wie eine Blaupause für unsere Gegenwart. Sie verhandelt die großen Fragen des Lebens: Warum sind wir hier? Wo kommen wir her? Und vor allem, wo gehen wir hin? Ich glaube, bei all den Krisen, mit denen wir momentan in der Welt konfrontiert sind, gibt uns Mahlers Musik immer das Gefühl, verstanden zu werden. Sie befähigt uns zu räsonieren und öffnet den Zugang zur Welt hinter der eigentlichen Welt. Darin liegt ihre Zeitlosigkeit. Außerdem beruft sich Mahler auf 400 Jahre Musikgeschichte: Da ist Bach genauso enthalten wie Mozart, Johann Strauss und sogar Collagetechniken, die wir eigentlich erst aus der Neuen Musik des 20. Jahrhunderts kennen: Plötzlich sehen wir Kuhherden durch das imaginäre Bild rennen, man hört jüdische Kaffeehausmusiker ebenso wie alte k. u. k.-Militärkapellen aufspielen. Das ist alles unfassbar radikal und modern.
Sie sagen, Sie möchten in einen „aktiven Dialog mit der Geschichte des Orchesters“ treten. Was heißt das konkret – abgesehen von der Beschäftigung mit Mahler?
Poschner: Im Paul-Sacher-Institut lagern viele unglaubliche musikalische Schätze aus dem 20. Jahrhundert, die mir eine große Inspiration sein werden und die in der Geschichte Basels eine wichtige Rolle spielen. Außerdem ist das Orchester extrem fit in allen Belangen und Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis, was besonders das Verdienst meines Vorgängers Ivor Bolton ist. Es ist mir daher auch eine große Freude, Musik des 17. und 18. Jahrhundert aufzuführen. Gleichwohl gehen vom Jazz Campus experimentierfreudige und vorwärtsgewandte Impulse aus, die mich sehr interessieren.
Es reizt Sie also, mit dem Sinfonieorchester auch Jazz zu spielen?
Poschner: Unbedingt! Ich denke viel darüber nach, wie man improvisierte und notierte Musik in einem Orchester zusammenbringen kann. Ich will aber gleich hinterherschicken, dass ich versuche, diese Etiketten zu vermeiden. Jazz ist für mich nur ein anderer Begriff von Freiheit. Es geht in der Musik immer darum, was man ausdrücken will. Die Syntax, die Semantik, der Dialekt, die Mittel sozusagen, sind dabei völlig sekundär.

Sie sagten einmal, Sie hätten von Keith Jarrett die Art des Hörens gelernt.
Poschner: Mir fällt kaum ein Künstler ein, der spontaner und aufregender improvisieren konnte als er, das heißt, nicht die Dinge reproduzieren, die man schon in sich trägt und von denen man weiß, dass sie gut funktionieren, sondern wirklich aus dem Moment heraus zu schöpfen, einzig allein im Jetzt aufzugehen. Das gehört zum Allerschwersten. Wenn ich Keith Jarrett richtig verstanden habe, ging es ihm immer nur um absolute Freiheit und Verbundenheit mit sich selbst. Und diese Freiheit existiert eigentlich auch in meiner klassischen Welt, obwohl ich als Interpret an den Text gebunden bin. Ich habe eben erst die „Fledermaus“ an der Wiener Staatsoper mit Jonas Kaufmann und Diana Damrau dirigiert. Alle haben die Musik so verinnerlicht, dass die kleinsten Nuancen im Moment und aus einem spontanen Gefühl heraus entschieden werden konnten. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, sich im Moment ganz fallen lassen zu können.
Sie sind seit vielen Jahren in der Schweiz tätig. Was unterscheidet die künstlerische Arbeit dort von der in Wien oder in Salt Lake City?
Poschner: Es geht ja in meinem Beruf immer darum, sich wie Archäologen an einer Sache festzubeißen, um sie bis ins letzte Detail zu ergründen. An all den Orten, die Sie aufgezählt haben, fühle ich mich jeweils wie eine Art Geburtshelfer, der den Kern der jeweiligen Identität hervorbringen will. Manchmal habe ich das gleiche Werk dabei, aber die Geschichte, die das Orchester und ich gemeinsam erzählen, sind grundverschieden, eben auf Grund der eigenen Sozialisierung, Klangkultur und Erfahrungen.
Im Herbst kommt die Chefposition beim ORF Radio-Symphonieorchester Wien dazu, 2027 jene beim Utah Symphony Orchestra. Wie jonglieren Sie zwischen den drei Klangfamilien?
Poschner: Für mich ist das Wichtigste, dass ich mich bei allen dreien auf unterschiedlichste Art und Weise musikalisch verstanden und zu Hause fühle. Ich muss nicht viel erklären. Dadurch ist die Verbindung zur Mentalität, zu den Emotionen der Menschen eine direktere – und darum geht es beim Musizieren. Amerika ist angesichts der sehr beängstigenden Umwälzungen, die dort aktuell stattfinden, sehr herausfordernd. Als Kulturschaffende sind wir gerade jetzt aufgefordert, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und Jahre zu warten, bis sich die Situation hoffentlich von alleine wieder zum Positiven wendet, sondern wir müssen sofort ein klares Zeichen setzen: Wir bringen Menschen zusammen, wir zeigen wie wichtig Resonanz, Respekt und gegenseitiges Zuhören sind. Und vom Zuhören verstehen wir als Orchester ziemlich viel. Wir können die Gestaltung der Welt nicht den Politikern alleine überlassen. Das gilt übrigens für jedes andere Land auch. Wien ist eine ewige und alte Liebe von mir. Ich lebe dort und kenne das RSO seit mehr als zehn Jahren. Ich habe mich außerdem ganz bewusst entschieden, nach Linz und Bremen und damit nach fast 20 Jahren als Generalmusikdirektor kein Opernhaus mehr zu leiten.
Musikvermittlung ist für Sie eine Herzensangelegenheit. Wieso?
Poschner: Es ist längst nicht mehr so, abends einfach den Konzertsaal aufzusperren, das Licht einzuschalten und zu glauben, dass die Menschen schon kommen werden. Wir müssen unterschiedlichste Brücken bauen, um allen zu zeigen, wie wichtig das gemeinsame Erleben ist. Musik ist eine Erfahrung jenseits des Verstandes, bei der es kein Richtig und Falsch gibt. Leider sind wir in der Klassik manchmal immer noch zu elitär. Viele denken, sie würden eine Bruckner-Sinfonie oder eine Mozart-Oper nicht durchstehen. Sie meinen, sie wüssten nicht, wie sie sich verhalten sollten, sie hätten Angst vor Überforderung. Leider führt das dazu, dass sie diese wunderbare Welt der Musik nie betreten. Ein schreckliches Missverständnis. Dagegen müssen wir aktiv werden. Es ist in unserer Verantwortung auf die Menschen zuzugehen, Vertrauen herzustellen, mit viel Mut, unkonventionellen Ideen und Fantasie.
Aktuelles Album:

Tschaikowsky: Manfred-Sinfonie op. 58
Orchestra della Svizzera italiana, Markus Poschner (Leitung).
Claves